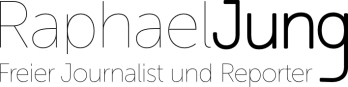„Das war wie ein neues Leben“
300 Gramm Brot, eine dünne Fischsuppe und Hirsebrei: Das bekam Günter Wellkisch als sowjetischer Kriegsgefangener im Arbeitslager in Sibirien. Er war einer von 1,5 Millionen Kriegsheimkehrern, für die in Frankfurt (Oder) ein neues Leben begann.
Es ist ein vergilbter Fetzen Papier, ausgestellt am 31. Mai 1949. Er bescheinigt, dass der in Guben geborene Günter Wellkisch wieder ein freier Mann ist. „Wie haben Dich die Russen eigentlich genannt?“ fragt seine Tochter Marina Runge. „Wojnaplenny“ antwortet Wellkisch – Kriegsgefangener. Seiner Familie hat der 91-Jährige aus Wellmitz bei Guben oft davon erzählt, was ihm in seiner Jugend widererfahren ist.
Zwangsarbeit im Steinbruch
Günter Wellkisch ist Sechzehn, als er im Januar 1945 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wird. Es sind die letzten Monate des Zweiten Weltkrieges. Als die Kapitulation bereits unterschrieben ist, wird er im heutigen Tschechien von sowjetischen Soldaten gefangen genommen. Einige Wochen verbringt er in einem Kriegsgefangenenlager, dann muss er zusammen fünfzig anderen Kriegsgefangenen einen Wagon besteigen und fährt Richtung Sibirien. Als er nach vier Wochen ankommt, wiegt er nur noch 40 Kilo.
In Sibirien muss Günter Wellkisch arbeiten: Acht bis zehn Stunden täglich, im Arbeitslager II bei Tscheljabinsk. „Im Steinbruch, im Zementwerk und auf dem Kolchos – bei minus 40 Grad Kälte. Ohne Wintersachen!“ Dass er nur 1,64 Meter groß sei, habe an der Unterernährung gelegen – in der Gefangenschaft sei er einfach nicht mehr gewachsen, erzählt er. Fast vier Jahre verbringt Wellkisch in Sibirien, bis er im Mai 1949 endlich mit einem Transport zurück nach Deutschland darf. In die Heimat, wie er sagt.
Heimkehr nach Frankfurt (Oder)
Wenn der 91-Jährige von seiner Heimkehr berichtet, beginnen seine Augen zu leuchten. Es war einer der entscheidenden Momente in seinem Leben. Einer, auf den er lange gewartet hat. Er sehe es heute noch vor sich, sagt er: „Wir wurden in Hundertschaften eingeteilt und mit Holzschuhen, Pelzmütze und Pelzjacke mussten wir antreten und dann über die Kreuzung Westkreuz nach Gronenfelde ins Heimkehrerlager. Das war für mich, wie soll ich sagen“ – er hält kurz inne –„wie ein neues Leben.“
Um die 1,5 Millionen Kriegsheimkehrer kommen zwischen 1945 und 1956 in Frankfurt an und werden dort aus der Gefangenschaft entlassen worden. Die Stadt habe für die deutsche Nachkriegsgeschichte eine zentrale Bedeutung, sagt Wolfgang Buwert vom Historischen Verein Frankfurt (Oder). Die Dimension sei eigentlich kaum vorstellbar: Fast täglich rollten Züge mit Kriegsgefangenen über die Oder – eintausend, zweitausend, dreitausend Mann. Eine enorme Herausforderung für die vom Krieg stark zerstörte Stadt.
Nicht immer reichten die Kräfte
Aus Gesprächen und Zeitzeugenberichten weiß Buwert auch: Einige Heimkehrer schafften es zwar noch bis nach Frankfurt, weiter reichten die Kräfte aber nicht mehr. „Die Männer hatten das Ziel, Deutschland zu erreichen – obwohl sie mitunter sehr krank waren. Da sind dann viele am Straßenrand sitzen geblieben, konnten einfach nicht weiter und sind tot gewesen.“ Ein Pferdewagen sei in den ersten Nachkriegsjahren mehrmals am Tag durch die Straßen gefahren, um die Toten aufzusammeln.
Nach ihrer Entlassung aus der Gefangenschaft kamen die Heimkehrer ins Lager Gronenfelde. Dort wurden sie entlaust, mit Essen und frischer Kleidung versorgt und mit Zügen in ihre jeweiligen Heimatregionen geschickt – sofern sie noch eine Heimat hatten. Denn mindestens jeder fünfte Heimkehrer kam aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und musste ganz neu anfangen. Viele von ihnen fuhren weiter nach Friedland, ins zentrale Aufnahmelager der Bundesrepublik für Heimkehrer und Vertriebene.
In Frankfurt (Oder) ist die Geschichte der Heimkehrer heute weitgehend vergessen, meint Karl-Konrad Tschäpe, Historiker in der Gedenkstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft“. Ein Grund dafür sei, dass die Erfahrungen der Kriegsheimkehrer in der DDR niemals Thema waren. Zwar habe man sich im Familien- und Freundeskreis über die Erfahrungen in den sowjetischen Lagern austauschen können. Eine öffentliche Diskussion darüber habe es aber nicht gegeben. So sei die Geschichte der Heimkehrer in Frankfurt (Oder) erst in den 90er Jahren aufgearbeitet geworden.
Ausstellungen und Mahnmale
Inzwischen gibt es in der Stadt einige Erinnerungszeichen. Unweit der Deponie Seefichten, wo einst das Heimkehrerlager Gronenfelde war, befindet sich ein Gedenkstein. Vor der Hornkaserne, der heutigen Polizeidirektion Ost, steht das 1998 vom Heimkehrerverband gestiftete „Mahnmal für den Frieden“. Im Polizeipräsidium selbst ist die Ausstellung „Willkommen in der Heimat“ über die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangener zu sehen. Sie kann nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.
In der Gedenkstätte „Opfer politischer Gewaltherrschaft“ erinnert noch bis 31. März die Sonderausstellung „70 Jahre Heimkehr“ an die Geschichten und Schicksale der Heimkehrer. Dass Frankfurt in den Nachkriegsjahren für über 1,5 Millionen Kriegsgefangene wie Günter Wellkisch der Freiheits- und Hoffnungsort war, wissen nur wenige Besucher, erzählt Karl-Konrad Tschäpe. „Viele kommen in die Ausstellung und sind erstaunt, was hier passiert ist“.

Sendung: Kowalski & Schmidt, 09.03.2019, 17.25 Uhr